Traum im Polarnebel
Juri Rytchëu
Roman
Erste Buchausgabe 1968
Gelesene Ausgabe: Unionsverlag
369 Seiten
3. Auflage 1991
Rezension vom August 2023

Nach zwei eher sommerlichen Geschichten greife ich zu einem Buch, das gut zu einem wärmenden Kaminfeuer im Winter passt. Schon der Titel verrät, dass wir uns mit "Traum im Polarnebel" in die Kälte begeben. Wohin, erfahre ich in der Beschreibung über den Autor im Klappentext des Buches und auf der ersten Doppelseite, die eine Landkarte abbildet. Juri Rytchëu kam 1930 als Sohn eines armen Jägers in der Siedlung Uelen auf der Tschuktschenhalbinsel im äussersten Nordosten Sibiriens zur Welt, im selben Jahr, in dem erstmals die tschuktschische Schriftsprache fixiert wurde. Als erster Schriftsteller eines Volkes mit nicht mehr als zwölftausend Menschen bringt Rytchëu den Lesern mit seinen Romanen und Erzählungen den Legendenkreis eines vergessenen Volkes und einer bedrohten Kultur näher. Juri Rytchëu lebte von 1930 bis 2008 und hat während seines Schaffens auch russische Klassiker in die tschuktschische Sprache übersetzt.
"Traum im Polarnebel" ist kein Buch, dass man unbedingt gelesen haben muss. Trotzdem empfehle ich die Lektüre. In einer schlichten, ruhigen, bildgewaltigen, unverblümten Sprache, die mich etwas an Hemingways Existenzialismus erinnert, hier jedoch mehr dem russischen Realismus folgt, führt uns der Autor die nackte Realität vor Augen, den existenziellen Überlebenskampf eines Naturvolkes in unmenschlichen Verhältnissen nördlich des Polarkreises. Vielleicht ist auf den knapp 370 Seiten etwas viel von Walrosshäuten, Seehundfett und Tranlampen die Rede, aber es stört nicht – im Gegenteil, es versetzt den Leser gnadenlos an die unwirtliche Eismeerküste der Tundra und in den Alltag dieser auf primitivste Weise lebenden Tschuktschen.

Was passiert? Ein amerikanisches Schiff bleibt im Packeis stecken und wird an die Küste gedrückt – vor die Siedlung Enmyn, wo einige Tschuktschen in ihren Jarangas leben. Beim Versuch, die Bordwand vom Eis loszusprengen, verletzt sich der junge Kanadier John MacLennan beide Hände. Kapitän Hugh, dem Siedlungsältesten der Tschuktschen durch gelegentlichen Tauschhandel bekannt, bittet die Tschuktschen, John auf Hundeschlitten in den fernen Ort Anadyr in eine Krankenstation zu bringen, und verspricht ihm dafür Waren und Winchestergewehre. Unterwegs erleidet John den Wundbrand, sodass sie im Lager der Rentiertschuktschen Zwischenhalt machen müssen. Dort wird der Patient von der Schamanin Kelana behandelt. Sie muss ihm sämtliche Finger amputieren. John ist danach geheilt, weshalb die drei Tschuktschen Orwo, Armol und Toko mit ihm an die Küste zurückkehren. In der Zwischenzeit hat das Schiff aber günstige Wetterbedingungen ausgenutzt und ist ohne den jungen Kanadier, Freund und engsten Vertrauten des Kapitäns ausgelaufen. John wird seinem Schicksal überlassen.
“

Bereits mit dieser Ausgangslage der Geschichte, indem ein Kamerad und Freund einfach seinem Schicksal überlassen wird, möchte der Autor auf eine Wesensart der zivilisierten Welt hindeuten, die den Tschuktschen fremd ist. Weisse, wie sie bei ihnen genannt werden, sind keine echten Menschen. Und auch später, vor allem in der zweiten Hälfte des Buches, wo Handelsgüter und Technik vermehrt auf Jagdverhalten und Genuss der Tschuktschen Einfluss nehmen, arbeitet Rytchëu immer wieder scharfe Gegensätze zwischen der zivilisierten Welt und dem Naturvolk heraus, ohne jedoch die Werte seines Volkes in ein besseres Licht rücken zu wollen. Ihm geht es lediglich darum, mit dieser Geschichte Denkweise, Handeln, Sitten und Bräuche dieser Menschen näherzubringen - ihren Legendenkreis, der auf der archaischsten Form des Schamanismus beruht.
“
John MacLennan, in Ontario beheimatet, muss den harten Winter mit den Tschuktschen verbringen. Er findet Unterkunft in der Jaranga von Toko und Pylmau mit ihrem kleinen Sohn Jako. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, nicht nur ohne Hände, auch mit den Gepflogenheiten seiner neuen Mitmenschen zurechtzukommen, gelingt John immer mehr, sich der Lebensweise der Tschuktschen anzupassen. Er lernt ihre Sprache, lernt ohne den Gebrauch von Fingern zu jagen und wie die anderen in der rauhen, eiskalten Wildnis zu überleben – und kommt nach anfänglichen Schwierigkeiten bald zum Entschluss, nicht mehr in die Zivilisation zurückkehren zu wollen.
Dann passiert ein tragischer Zwischenfall: sein Freund und Gastgeber Toko kommt beim Jagen im Packeis ums Leben, wofür John sich die Schuld gibt. Zuhause wäre er verurteilt und ausgegrenzt worden, die Tschuktschen hingegen tragen ihm nach einer schamanistischen Befragung des Toten im Beisein der Götter keine Schuld auf, sondern Verantwortung, indem er von nun an für Tokos Familie aufkommen darf. Dass er Pylmau sogar zu seiner Frau nehmen kann, fällt John nicht schwer, da er schon vorher Gefühle für sie hegt. So gewinnt John nicht nur eine neue Familie, sondern entdeckt auch eine neue, bewusste Lebensweise, aufrichtige Werte im Leben, die aus ihm einen anderen Menschen machen – einen wahren Menschen, wie die Tschuktschen über sich selbst sagen.

“
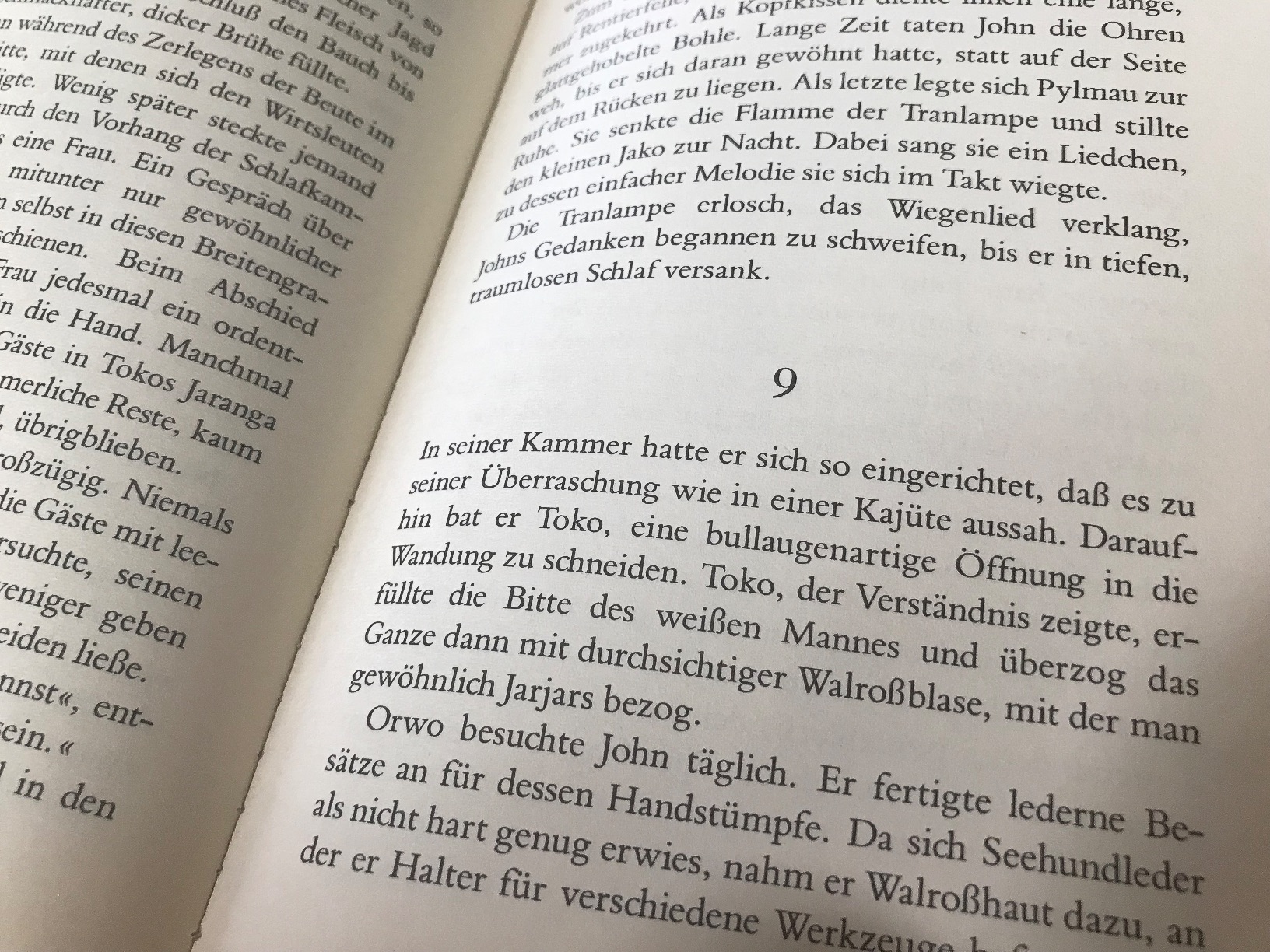
John MacLennan, der im Verlauf der Jahre durch den Besuch von Händlern, russischen und amerikanischen Schiffs- und Expeditionsleuten mehrmals die Möglichkeit hätte, in die zivilisierte Welt zurückzukehren, bleibt seiner Überzeugung, ein neues Leben gefunden zu haben und für die Werte des Tschuktschenvolkes einzustehen, treu. Achtung Spoiler: Selbst als seine Mutter anreist, die aufgrund einer Nachricht des Händlers Carpenter von Johns Aufenthaltsort erfährt, beweist John seine Standhaftigkeit. Erst von widersprüchlichen Gefühlen überwältigt, entschliesst er sich zu bleiben und lässt sie ohne ihn wieder abreisen.
“
(S. 81)